Salvum me fac — Ps. XI (12)
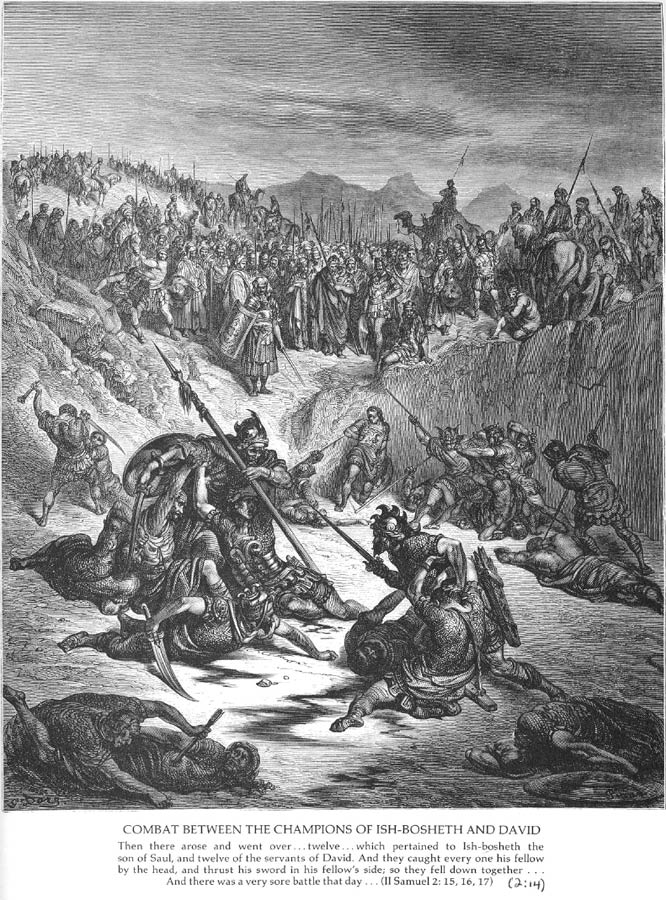
Du Herr, wirst uns behüten und uns vor diesen Leuten für immer bewahren
Dieser Psalm enthält eine Klage auf den Zustand der Welt in Worten, die auch heute fast ebenso gesprochen werden könnten. Dabei hängt das Verständnis freilich sehr stark von einem einzigen Wort (hasid) in der ersten Zeile ab, das im hebräischen etwas wie „gottgefällig“ bedeutet und sowohl auf die Einhaltung der göttlichen Ordnung als auch die irdische Rechtlichkeit abzielt. Für die frommen Juden konnte es da keinen Unterschied geben, und für die christlichen Übersetzer der Vulgata noch weniger: Sie wenden den Blick entschlossen zum Überirdischen und übersetzen entschlossen „das Heilige (sanctus) wird weniger“.
In jedem Fall enthält die erste Strophen, eingeleitet von einer Bitte um Abhilfe, die Beschreibung eines überaus beunruhigenden Zustandes der Welt: Die Frommen und Gottesfürchtigen werden weniger, und Lüge und Täuschung nehmen überhand. Die zweite Strophe greift die Bitte um Abhilfe auf – der Herr möge die lügnerischen Münder zum Schweigen bringen – und skiziert ein bestürzend aktuelles Psychogramm der Urheber und Verbreiter der Unwahrheit. In einer nur leicht modernisierten Diktion: Durch unsere Reden sind wir mächtig, wir sind die Herren, des Diskurses, wir haben die Macht. Die darauf folgenden abschließenden Verse lassen erkennen, daß die Klage über Lüge und Täuschung auch hier schon eine weltliche Perspektive hat. Es geht nicht nur um die göttliche Wahrheit und das Heilige, sondern es geht ebenso um Untreue und Betrug unter den Menschen, ausgeübt von den Starken zum Nachteil der Schwachen.
Die zum Schluß vorweggenommene Erfüllung des Gebetes scheint diesen irdischen Aspekt besonders zu betonen: Wegen des Stöhnens der Bedürftigen verspricht der Herr, sich zu erheben und seinen Beistand zu gewähren. Anders als die zu Eingang beklagten Lügen und Täuschungen der Menschen sind seine Worte verläßlich wie geläutertes Silber. Der Herr wird die Seinen vor dem verlogenen Treiben dieser üblen Zeitgenossen bewahren, und wenn deren Zahl auch noch so groß wird.
Moderne Erklärer wie Erich Zenger reduzieren den Psalm im wesentlichen auf diesen irdischen Aspekt und verwenden viel Scharfsinn darauf, die soziale Situation seiner Entstehung (Unterdrückung und Klassenkampf) nachzuzeichnen. Das mag nicht völlig unberechtigt sein, wird der Bedeutung dieses Gebetes weder für Juden noch für Christen wirklich gerecht. Auch die hier zu Rate gezogenen jüdischen Übersetzungen halten sich von dieser Engführung fern und bleiben bei der im hebräischen (und ebenso im griechischen) alten Text angelegten Mehrdeutigkeit: Frömmigkeit und Rechtlichkeit sind Eines. Die Gott gefällige Wahrheit und Treue lassen sich nicht auf die von Zenger angeführten gefälschten Gewichtsteine betrügerischer Markthändler reduzieren.
In Psalm 11 tritt ein sprachliches Problem in Erscheinung, das viele Psalmen und sämtliche Bücher des Alten Testaments durchzieht und die Übersetzung oft erschwert. Das Hebräische hat für den allgemeinen Begriff „Gott“ das Wort „El(ohim)“. Elohim ist formal ein Plural und kann auch als Plural gebraucht werden: Die „Götter“ (gemeint ist eher „Götzen“) sind nur Machwerke aus Silber und Gold, Psalm 134). Meistens wird „Elohim“ jedoch gebraucht, um Gott, den einzigen wahren Gott, zu bezeichnen. Außerdem, und in vielen Zusammenhängen bevorzugt, kann das Volk Israel seinen Gott auch bei seinem persönlichen Eigennamen „Jahweh“ nennen. Dieser Eigenname wird stets nur „JHWH“ geschrieben, seit dem 3. oder 4. Jahrhundert v. Chr. aber nicht mehr ausgesprochen, sondern mit „Adonai“ (der Herr) umschrieben. Ursprung des Brauchs, der sich im Lauf der Zeit zum starken Tabu verfestigte, war das Bestreben, den Namen Gottes vor Mißbrauch (durch Fluch oder Zauberei) zu bewahren, wie es das dritte Gebot gebieterisch verlangt.
Die genaue Aussprache und Bedeutung von „JHWH“ sind nicht überliefert und sollen auch hier nicht problematisiert werden. Ein Problem für die Übersetzungen besteht darin, daß das griechische AT Elohim mit „Theos“ und „Jahweh“ mit „Kyrios“ wiedergibt – Latein folgt dem mit „Deus“ und „Dominus“, das Deutsche mit „Gott“ und „(der) Herr“. In all diesen Sprachen geht dadurch bei der Wiedergabe von „JHWH“ der Charakter des Eigennamens und der persönlichen Anrede verloren – und das ist nicht nur bei Psalm 82 (83) ein Problem, wo viele Übersetzungen schreiben “Herr ist Dein Name“. Hier wird die nicht nur in der gesprochenen Sprache, sondern auch in der Schrift erfolgende Meidung des Gottesnamens zum Verständnisproblem. Es gab übrigens allerdings nur fragmentarisch erhaltene griechische Übersetzungen des Alten Testaments aus vorchristlicher Zeit, die im griechischen Text das Tetragramm „JHWH“ in hebräischer Schrift beibehielten. Wie das dann gelesenen wurde, „adonai“ oder „Kyrios“, ist nicht überliefert.
Auch die ältere Version (1980) der insgesamt trotz einiger guten Seiten problematischen „Einheitsübersetzung hat in Psalm 82 das sinnwiedrige „Herr ist dein Name“. Die neue Version von 2016 sucht das Heil in der Konvention, HERR überall dort, wo es für den Gottesnamen steht, in Kapitälchen (kleinen Großbuchstaben) zu schreiben, also „HERR ist dein Name“. Auch m.E. nicht wirklich überzeugend. Immerhin erlaubt das in Psalm 11 (12) V. 5 den Ausweg, bei einem hebräischen Gebrauch von „adonai“ im gewöhnlichen Sinne (also nicht als Stellvertreter für das Tetragramm) zu schreiben: „Wer ist Herr über uns? Die Vulgata ignoriert das Problem an dieser Stelle – oder gibt ihm eine positive interpretatorische Wendung – wenn sie großgeschrieben schreibt: „quis noster Dominus est“. Wer ist für uns (wie) Gott? Eine unverkennbare Anspielung auf oder Übernahme aus Psalm 112, v. 5: Quis sicut Dominus Deus noster, und von der Sinngebung her durchaus nachvollziehbar. In der Ferne hört man den Nachhall des Kampfrufes von Michael gegen den aufständischen Fürsten der Finsternis.
Im ganzen Psalm 11 einen Nachhall dieses Kampfes zu hören, ist nicht verfehlt und trifft den Sinn des Gebetes sicher besser als die „Armentheologie“ der Modernisten.
Letzte Bearbeitung: 25. März 2024
*