Confitebor tibi — Ps. IX
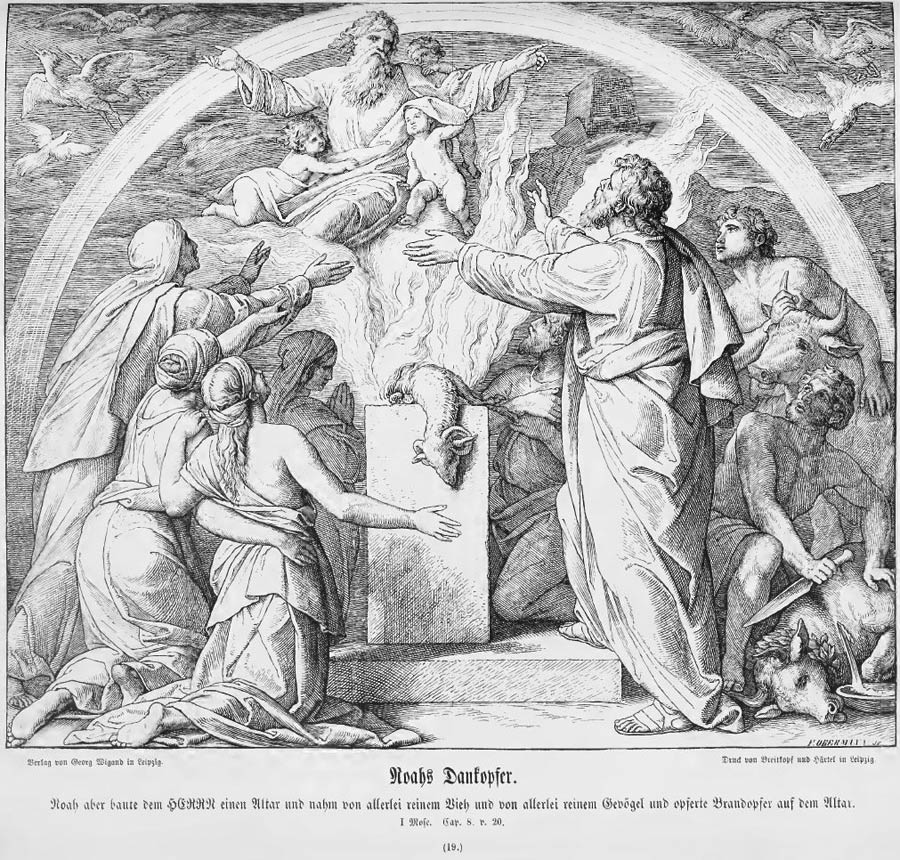
„Du hast die Völker bedroht, die Frevler vernichtet, ihren Namen gelöscht für immer und ewig.“
Mit Psalm 9 endet bis auf weiteres die übereinstimmende Nummerierung der Psalmen in der griechischen und der masoretischen Tradition. Die Masoreten haben den Psalm (nicht ohne jeden Grund) geteilt und der zweiten Hälfte eine eigene Nummer gegeben – so kommen sie für die folgenden Gesänge auf einen um 1 größeren Zähler, bis beide Zählungen in Nummer 147 wieder zusammenfinden. Die griechische Version hat die ursprüngliche Einheit von Psalm 9 bewahrt, die daran zu erkennen ist, daß die Strophen der beiden Psalmhäftern quasi einheitlich „durchnummeriert“ sind: Die Strophen beginnen der Reihe nach mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets; durchgängig von Beginn Psalm 9 bis Ende Psalm 10 der masoretischen Zählung.
Für den Beter ist diese unterschiedliche Einteilung zunächst ohne größere Bedeutung – bis er dahinter kommt, daß die von den Juden beibehaltene und von der protestantischen Bibelwissenschaft aufgenommene masoretische Nummerierung in vielem auch eine Absage an die Tradition der Kirche zum Ausdruck bringen will.
Konsequenterweise hat denn auch die modernistische Theologie dieses Vorbild übernommen – Sinnbild für den Vorrang (vermeinlicher) Ökumene vor der Tradition. Und gerade deshalb bleiben wir hier bei der traditionellen Zählweise nach Septuaginta und Vulgata, wie sie auch bei den Kirchenvätern und der traditionellen Theologie, im überlieferten Brevier und in allen Büchern der Orthodoxie verwandt wird. Um den Zugang zu modernerer Literatur zu den Psalmen zu erleichtern (die auf keinen Fall rundheraus abzulehnen ist), fügen wir jedoch zumindest in den Kapitelüberschriften die masoretisch/moderne Zählung in Klammern dazu.
Die erste Hälfte des auch in der Vulgata deutlich aus zwei Abschnitten bestehenden Psalms 9 ist ein Loblied auf den Herrn, der auf Sion wohnt (V. 12) und ein Dank für die großen Taten und die Gunst, die er seinem Volk erwiesen hat, verbunden mit der Erwartung, daß der Herr diesem seinen Volk auch in Zukunft beistehen werde. Der Grund für dieses vertrauensvolle Erwartung ist die Gewissheit, daß Jahwe der Herr derGeschichte ist und kein Mensch und kein Volk sich seiner Macht entziehen kann.
Diesem eher allgemeinen und wenn man so will „theologischen“ Teil folgt im zweiten Abschnitt bzw. in masoretisch Nr. 10 ein Klagelied, das eine als gegenwärtig erlebte Notlage in ihren konkreten Erscheinungsformen beschreibt und dabei die Gottlosen und die Sünder als die daran Schuldigen auf vielerlei Weise konkret anspricht. Die klagende und abwehrende Beschäftigung mit den Gottlosen, ihren bösen Taten und ihren Motiven steht hier ganz klar im Voreergrund. Erst ganz am Schluß dieses Teils (V. 16-18) findet der Psalm dann zu der vertrauensvollen Gewissheit in die letztlich siegreiche Macht Gottes, die logisch die Voraussetzung zu dem im ersten Teil bereits vorausgreifend verkündeten Lob und Dank bildet.
Solche Umkehrungen in der Abfolge von Schilderung einer Notlage und Dank für die Errettung kommen auch an anderer Stelle in den Psalmen gelegentlich vor – das gibt also hier kein zwingendes Argument weder dafür noch dagegen, die beiden Teile von Psalm 9 als eines oder zwei Lieder zu betrachten. Für den Beter kann das Durchschauen dieses umgekehrten Zusammenhanges jedoch eine große Hilfe bieten – zumal die Beschreibung der bestehenden Not bei aller Konkretheit in den Bilden genug Allgemeingültiges enthält, um auch zutreffenden Ausdruck von Nöten und Beklemmungen des 21. Jahrhunderts darzustellen. Habgier, Korruption, Herrschsuch und Arroganz der Mächtigen sind heute ebenso verbreitete Übel wie sie hier vor über zweitausend Jahren beschrieben worden sind, und in der Suche nach den Ursachen hat der Psalm gegenwärtig beliebten sozialpsychologischen oder identitätspolitischen Ansätzen etwas genz wesentliches voraus: Immer wieder benennt er als Triebkraft des und der Bösen die Vorstellung, daß es keinen richtenden oder strafenden Gott gebe, letztlich die Gottlosigkeit als Lebensprinzip.
Erst indem diese Gottlosigkeit bekämpft und überwunden wird, öffnet sich der Weg zur „Erlösung von dem Übel“, wie sie im ersten Teil des Psalms in Lob und Dank besungen wird.
Bei der Darstellung dieses Übels im zweiten Teil dieses Psalms ist wie bereits angedeutet viel von den „Armen“ und „Waisen“ die Rede, die ausgebeutet oder sogar umgebracht werden. Das hat in der modernen Exegetik dazu geführt, aus diesem und anderen Psalmen eine besondere „Armentheologie“ mit nachgerade klassenkämpferischen Untertönen herauszulesen. Völlig aus der Luft gegriffen ist das nicht: Die Erlösungshoffnung des auserwählten Volkes hatte immer auch eine diesseitige Komponente, die vom verheißenen Messias die Errichtung eines irdischen Reiches der Gerechtigkeit (und der Vorherrschaft des so oft unterdrückten Israel) erwartete. Dabei gerät freilich leicht aus dem Blick, daß „Armut“ im alten Testament und auch zur Zeit Jesu immer und an erster Stelle auch eine geistige und geistliche Dimension hat: „Selig sind die Armen im Geiste“.
Die „Armen“ des alten Testaments sind keine besitzlosen Bettler (von denen es auch genug gab), sondern die „kleinen Leute“ bis zu dem, was wir heute „Mittelstand“ nennen würden, die keinen Einfluß auf den Gang der Dinge hatten und von den Mächtigen zu Objekten ihrer Machtspiele gemacht wurden – was durchaus auch Tod und Verarmung mit sich bringen konnte. Die Überwindung der hier gemeinten Armut und Kleinheit erfolgt aber nicht primär durch Abschaffung von Ausbeutung und Ausbeutern – auch wenn es in einigen Versen der letzten Strophe durchaus Anklänge in diesr Richtung gibt – sondern durch Überwindung der Gottlosigkeit. Die Überwindung von Spaltung und Zwietracht in der Gesellschaft und unter den Völkern erfolgt nicht durch „gerechte Verteilung“ der Reichtümer der Erde, sondern durch die Anerkennung Gottes als des höchsten Gesetzgebers. „Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere hinzugegeben werden“ (Matth. 6, 33), wie der Messias das ausformuliert, was hier nur nur angelegt ist.
Letzte Bearbeitung: 21. März 2024
*