Domine, Dominus noster — Ps. VIII
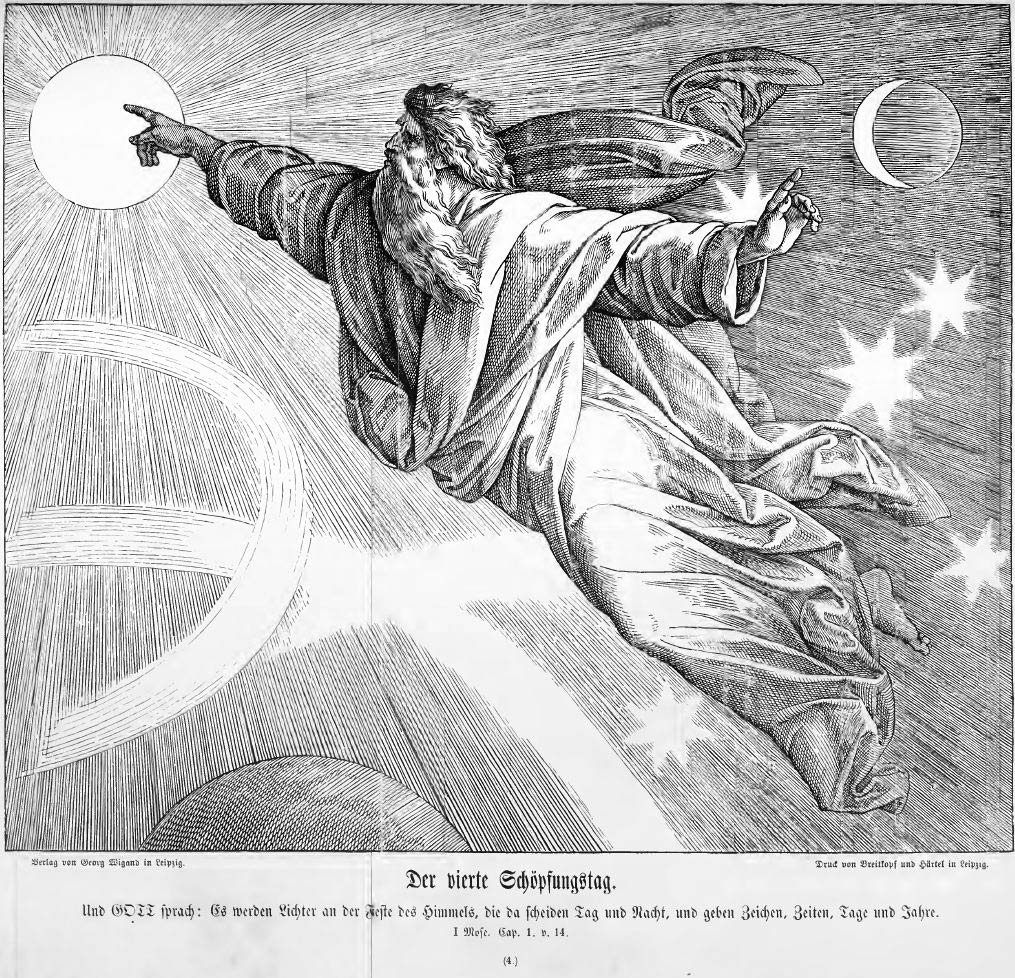
„Sehe ich den Himmel, das Werk Deiner Hände, Mond und Sterne, die Du befestigt.“ (Ps. VIII, 4)
Psalm 8 ist ein hymnischer Lobgesang an den Schöpfer, in dem der Mensch ihm dafür dankt, daß und wie er ihn erschaffen hat: als Krone der Schöpfung, dem alles Geschaffene untertan ist. Wenn der Beter sich erst einmal auf die „Lebenswelt“ der Entstehungszeit des Psalms und deren Schafe und Rinder eingestellt hat, bereitet der gläubige Mitvollzug dieses Gebetes auch im 21. Jahrhundert keine Probleme – wenn und soweit der Beter denn daran glaubt, daß es einen Gott gibt, dessen Geschöpf er ist. Eine leichte Schwierigkleit bereitet vielleicht Vers 3 mit der etwas fremdartigen, aber doch auch wieder leicht nachvollziehbaren Vorstellung, daß selbst Kinder und Säugline das Lob des Schöpfers zu singen vermögern – besser gesagt: verkörpern – so daß die Feinde des Schöpfers vergehen müssen. Alles, was nach dem Gesetz des Schöpfers besteht, singt alleine durch seine Existenz das Lob des Herrn.
Es gibt einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den – ansonsten weitgehend übereinstimmenden – Textfasungen aus der griechischen und aus der masoretischen Tradition: In der Septuaginta spricht Vers 6 davon, daß der Schöpfer „des Menschen Kind“ „nur ein weniges unter die Engel“ gestellt habe, nach der masoretischen Lesart, die auch wie meist unkommentiert von der Einheitsübersetzung übernommen wird, stehen die Menschenkinder „nur ein wenig unter Gott“.
Für das Verständnis der Juden zur Stellung des Menschen im irdischen und überirdischen Kosmos ist das ein großer Unterschied, denn die Frage, ob der Mensch seinen Platz in der Rangordnung über oder unter den Engeln hat, ist nach der in den Henoch-Schriften überlieferten Mythologie die Wurzel des großen Streites im Himmels, der schließlich zum Sturz des aufständischen Luzifer und seiner Verbündeten in die Hölle führte. Kein Wunder, daß diese Differenz sich auch in verschiedenen Psalmüberlieferungen niedergeschlagen hat.
Glücklicherweise muß das das Verständnis des Psalms für den Beter nicht belasten: Darin, daß „des Menschen Kind“ den höchsten Rang in der irdischen Schöpfung einnimmt, stimmen beide Lesarten im Literalsinn doch weitgehend überein. Und außerdem ist der uralte Streit nach christlichem Verständnis – das sich freilich weitgehend auf die vorchtristlichen mythologischen Vorstellungen stützt – inzwischen zu Gunsten der masoretischen Lesart entschieden: Königin der Engel ist das „Menschenkind“ Maria, und genau die Anerkennung dieser ihrer Rolle war nach alten christlichen Überlieferungen Ausgangspunkt des großen Streites zwischen Satan und Michael.
Soweit ein kurzer Ausflug in die Mythologie. Die frühe Theologie sieht die Dinge von einer etwas anderen Seite, und da kommt die Lesart der Septuaginta zur Geltung. Das zweite Kapitel des Briefes an die Hebräer zitiert genau diesen Vers 6 in der griechischen Lesart „unter die Engel“ und gibt überdiese eine präzisere und damit auch stärker einschränkende Interpretation der hier nicht ohne Absicht mehrfach zitierten Wendung „des Menschen Kind“. Danach bezieht der neutestamentliche Autor diese Formulierung nicht auf „den Menschen allgemein“, sondern ganz ausdrücklich auf den „Menschensohn“ Jesus Christus und kommentiert dann: „du hast ihn nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt; Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Hebr. 2,7). Dieses Verständnis liegt dann auch 1. Kor 15, 27 und Eph 1, 22 zugrunde und hat die Wahrnehmung von Psalm 8 (und vieler anderer Psalmen) durch die Kirchenväter maßgeblich geprägt. Sie lesen die Psalmen durchgämgig in der Vorausschau auf Christus und erschließen damit einen großen Reichtum an theologischen Einsichten und Denkmöglichkeiten. Gleichzeitig läuft dieser Ansatz jedoch Gefahr, den einfachen Beter, der die Psalmen lediglich zur Vorlage für sein ganz persönliches Gespräch mit Gott nehmen will und sich dabei in einer gewissen Kontinuität mit den Betern des alten Bundes sehen will, zu überfordern.
Noch weniger hilfreich als diese „fromme“ Methode ist die in der modernen Theologie durchgesetzte „wissenschaftliche“, die sich weitestgehend auf die masoretische Tradition beschränkt und dabei die Brücke zur Septuaginta/Vulgata und zur Frömmigkeit der Kirchenväter gewollt abbricht. Dann bekommt man z.B. für Psalm 8 freigiebig Auskunft über die möglichen Vorbilder einzelner Formulierungen in der altorientalischen Königsideologe – erfährt aber nichts über die christliche Lesart bei Paulus oder Augustinus. Statt dessen volle Verheutigung im säkularen Sinne: Aus der Lobpreisung Gottes in Psalm 8 wird ein Loblied auf die „Menschenwürde“ und die „Kinder und Säuglinge“ werden umgedeutet zu Chiffre für die kleinen Leute und Unterdrückten, deren Lage im Sinne der „Option für die Armen“ verbessert werden muß. Gewisse „sozialreformerischen“ Anklänge sind den Psalmen und ihrem oft auf das Irdische begrenzten Erwartungshorizont sicher nicht fremd. Aber ausgerechnet Psalm 8 auf diesen Horizont zu reduzieren, ist sowohl nach den angedeuteten Elementen der jüdischen Mythoogie als auch nach dem Verständnis des Apostels und der Kirchenväter völlig verfehlt.
Letzte Bearbeitung: 21. März 2024
*