Domine, ne in furore — Ps. VI
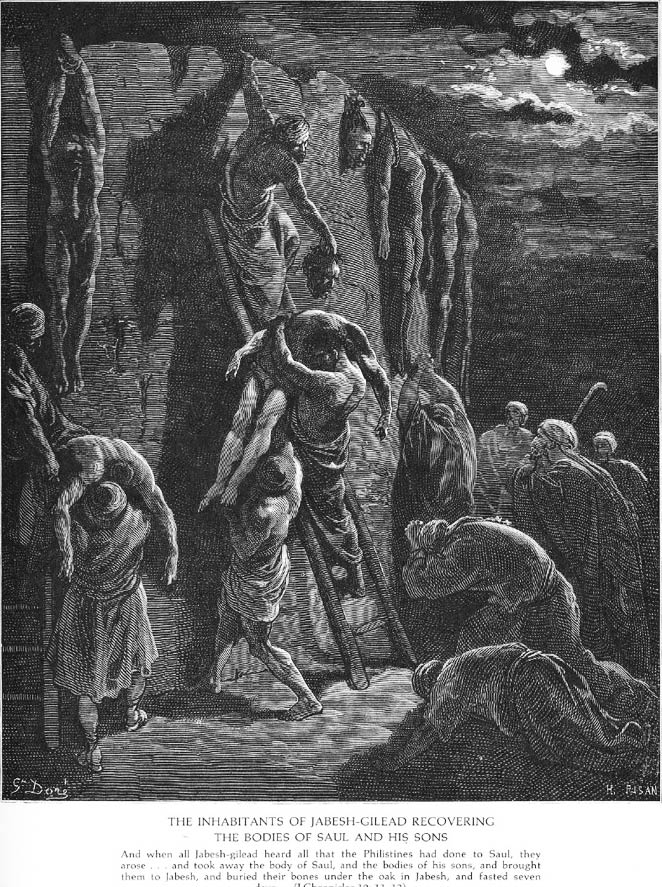
„Herr, strafe mich nicht in Deinem Zorn und züchtige mich nicht mit Deinem Grimm “ (Ps. VI, 6)
Inhaltlich schließt Psalm 6 exakt an die in #5 angerissene Problematik von Schuld und Vergebung, und die Frage nach diesem oder dem anderen Leben an. Ausgangspunkt ist das, wie wir heute sagen würden, „schlechte Gewissen“ des Beters, der sich seiner Verfehlungen und seines Ungenügens vor dem Gesetz bewußt ist. Das Alte Testament hat dafür die korrespondierenden Vorstellungen vom Zorn Gottes und der Furcht des Herrn entwickelt, die im gegenwärtig proklamierten Wohlfühl-Christentum weitgehend als „überwunden“ gelten. Zu Unrecht, denn das Schuldbewußtsein ist zweifellos eine Art anthropologische Konstante, und die Furcht des Herrn ist nach überlieferter Lehre der Kirche eine der Sieben Gaben des heiligen Geistes. Die Kirche zählt Psalm 6 denn auch zu den Sieben Bußpsalmen – die sechs anderen sind 31, 36, 50, 101, 129 und 142. Die Hervorhebung dieser sieben Psalmen als besondere Gruppe wird auf den hl. Augustinus zurückgeführt. Diese Gruppierung spielt im liturgischen Leben der Kirche, aber auch im privaten Gebet bis ins 20. Jahrhundert eine bedeutende Rolle, hat jedoch soweit ersichtlich kein Vorbild im alttestamentarischen Gebrauch.
Nach der Exposition in den ersten Versen schreitet der Psalm in 6,3 zu einer Konkretisierung fort: Der Beter leidet unter Krankheit (oder den Plagen hohen Alters), die er als „Vergeltung“ für vergangenes böses Handeln empfindet – und er wendet sich vertrauensvoll und bußbereit an den Herrn, ihm die Schuld zu erlassen.
Tatsächlich sind Buße und Reue nach 6,7 ein Schwerpunkt der Haltung, in der der Beter sich an Gott wendet – aber in Vers 6 zeichnet sich auch eine Art Tauschgeschäft ab: Wenn der alte oder sterbenskranke Beter in die Unterwelt fahren sollte, wird er nicht mehr in der Lage sein, Gott zu preisen. Das „Lob Gottes in der ganzen Gemeinde“, wie es in vielen Psalmen heißt, spielt in der Glaubenswelt des AT eine große Rolle, fast eine größere als die Gott nach seinen Anordnungen in Leviticus geschuldeten Opfer im Tempel. Der Herr ist nicht in irgendeinem Sinne abhängig von den Opfern und dem Lob seiner Gläubigen – aber ohne dieses Lob würde seiner Ehre doch etwas fehlen: Es wäre keiner mehr da, um ihm diese Ehre zu erweisen und dieses Lob zu singen.
Dazu kommt ein zweiter Gedanke: Der Beter hat trotz seiner eingestandenen Sündhaftigkeit doch das Bewußtsein, zu den „Guten“ zu gehören, zumindest immer sich redlich bemüht zu haben. Wenn es ihm dennoch in seiner jetzigen Notlage für alle erkennbar schlecht ergeht, sieht er selbst sich in seinem Vertrauen auf Gott enttäuscht – und die „Bösen“, die in den letzten Versen des Psalms als Plage für den Beter stärker in den Vordergrund treten als die Krankheit, könnten sich ermutigt sehen, in ihrem gottlosen Treiben fortzufahren. Warum sollte man sich, wie das etwa in Psalm 94 näher angesprochen ist, dem Gesetz Gottes unterwerfen, wenn er „es nicht sieht“, wenn sein Zorn ohne Gerechtigkeit und Erbarmen Gerechte wie Ungerechte trifft?
Nachdem der Beter so seine Argumente dafür ausgebreitet hat, warum er des Erbarmens Gottes würdig ist, ja, warum es quasi „im Eigeninteresse“ des Herrn liege, ihm sein Erbarmen nicht zu versagen kommt in Vers 9 der im Bittpsalm nachgerade zur Regel gehörende Umschlag: Kaum ist die Bitte ausgesprochen, ist sich der Beter auch der Erfüllung gewiss: „Erhört hat der Herr mein Flehen, aufgenommen hat der Herr mein Gebet“. Dieser eher ichbezogen anmutendenden Kundgebung folgt dann ebenso häufig noch eine Art „pastorale Nutzanwendung“: „Die Feinde sollen sich schämen und bereit sein zur Umkehr!“
Erich Zenger, dessen Psalmen-Erklärungen wir im Allgemeinen mit großer Skepsis begegnen, hat für die in diesem (und vielen anderen Psalmen) ausgedrückte Vorstellung einer zeitnah noch in diesem Leben erfolgenden Belohnung für gutes Leben (und Streben) einerseits und der Bestrafung von bösem Handeln andererseits den Ausdruck vom „Tun-Ergehen-Zusammenhang geprägt, den wir gerne übernehmen. Das Alte Testament hat nur eine sehr unklare – wenn überhaupt – Vorstellung vom Leben nach dem Tode und Gericht oder Bestrafung im Jenseits, der Horizont bleibt weitgehend auf das irdisch Wahrnehmbare begrenzt. Wo die Erfahrungen des realen Lebens aber zur Erkenntnis zwingen, daß es in Wirklichkeit ganz und gar nicht immer so kommt (etwa # 16/17), brechen schlimme Zweifel auf, die nur durch äußerste Anstrengung des Gottvertrauens überwunden werden können.
Das alttestamentarische Judentum ist zwar eine Buchreligion par Excellence, aber doch keine Religion eines systematisch dargelegten Glaubens. Es gibt keinen Katechismus der Orthodoxie, sondern das Gesetz der Orthopraxie und es gibt auch außer dem „Schma Iisrael“ kein Glaubensbekenntnis, wenn man von dem einen anderen Charakter aufweisenden Psalm 135 absieht. Der ist ein Lobpreis Gottes dafür, daß er ist, wie er ist, und für seine großen Taten. Ob er als Glaubensbekenntnis in unserem Sinne verstanden wurde, ist schwer zu sagen.
Wo die Christen seit frühester Zeit die Grundsätze ihres Glaubens in komplex aufgebauten Bekenntnistexten (Symbola) ausformulierten, steht bei den Juden – und in den Psalmen ganz besonders – das „Vertrauensbekenntnis“ ganz weit vorne. Nicht der Glaube rechtfertigt und rettet, auch nicht die (dennoch lobenswerten) guten Werke, sondern an erster Stelle rettet das unbedingte Vertrauen. Die Bekundung dieses unerschütterlichen Vertrauens auf Gott bildet den Grundton einer Mehrheit der Psalmen.
Auch im Christentum gehört das Gottvertrauen zu den Grundtugenden. Unbedingtes Gottvertrauen befähigte die Christen der frühen Zeit (und ihre späteren Nachfolger) zur Annahme des Martyriums oder die Missionare zu ihren Reisen bis ans Ende der Welt – die ebenfalls oft genug mit dem Martyrium endeten. Das Gottvertrauen spielt im gläubigen Volk beider Konfessionen eine überragende Rolle und hat in der nachreformatorischen Liederdichtung – die sich im übrigen oft eng an die Psalmen anlehnt – ihren prägnantesten Ausdruck gefunden: „Wer nur den lieben Gott läßt walten…“ (Georg Neumark); „Was Gott tut, das ist wohlgetan…“( Samuel Rodegast) Die neuere Theologie kann damit wenig anfangen – das seit Beginn der Neuzeit ständig zunehmende „Vertrauen in die eigene Kraft“ hat es an den Rand gedrängt. Im Katechismus von 1997 konnten wir das Stichwort „Gottvertrauen“ nur als „kindliches Vertrauen“ in einigen Abschnitten über das Beten auffinden.
Da sind die Psalmen ganz anders. Das „(Ich) vertrau auf Gott!“ kommt im Wortlaut oder nach dem Geist in buchstäblich jedem einzelnen von ihnen vor. Die Psalmen sind auch eine Schule – oder wenn man so einschränken will: eine Erinnerung – der überragende Stellung, die das Vertrauen in Gott im Glauben und im Leben der Menschen spielen sollte. Für die Juden der vorchristlichen Zeit war das eine absolute Selbstverständlichkeit – für Christen der Gegenwart gibt es da viel zu bedenken.
Letzte Bearbeitung: 21. März 2024
*