Verba mea auribus percipe — Ps. V
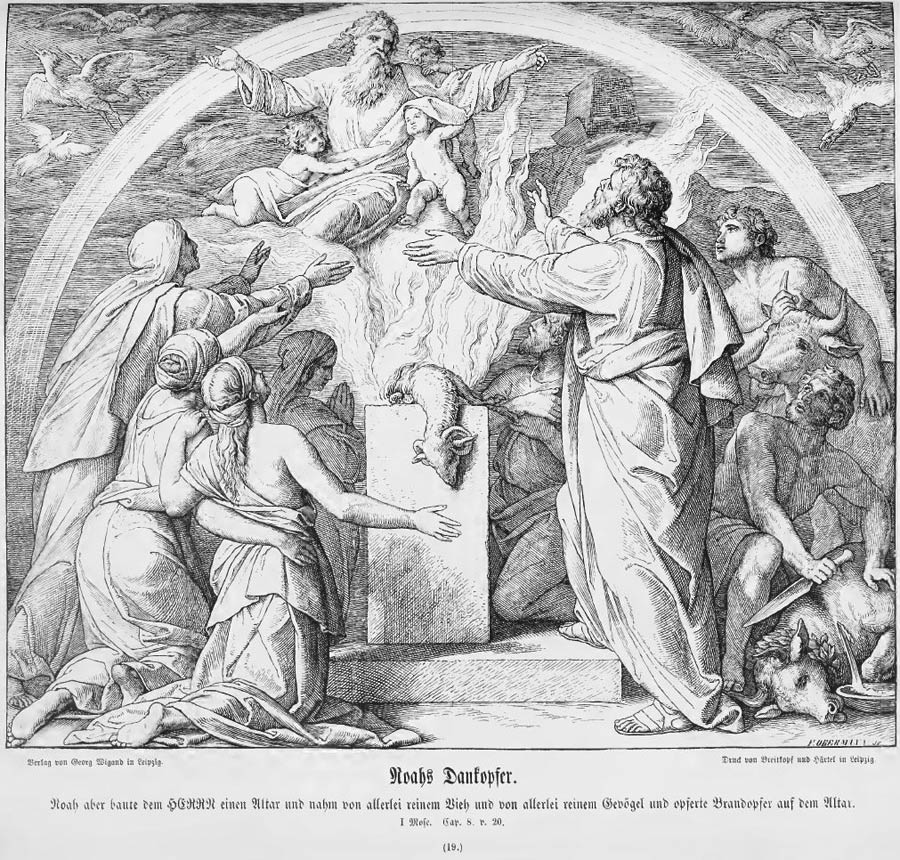
„Herr, am Morgen hörst Du meine Rufen, am Morgen rüste ich das Opfer zu (Ps. IV, 6)
Auch Psalm 5 fügt sich ein in die Reihe der Bittgebete eines frommen Gläubigen, der sich von Bösen verfolgt sieht. Wer die Bösen sind und worum es in der Sache geht, bleibt unausgesprochen – das öffnet den Psalm auch für den heutigen Beter, der die Leerstellen mit seinen eigenen Nöten und Anliegen auffüllen kann.
Dafür nimmt der Psalm aber in einer anderen Hinsicht unübersehbare Konkretisierungen vor. Er spricht von einem Zeitpunkt für das Gebet: „am Morgen“ – die Kirche hat den Psalm daher im Stundengebet für den Morgen vorgesehen und folgt damit vermutlich einer Tradition, die bis in die Zeit des Alten Testaments zurückreicht. Der Text deutet auch an, daß der Beter sich tatsächlich oder zumindest vorgestellt im Tempel vor dem Angesicht des Herrn befindet – also dort, wo nur diejenigen verweilen dürfen, die nicht durch böse Taten den Zorn und den Abscheu Gottes auf sich gezogen haben. Das ist eine typische Denkfigur des alten Testaments – der Gedanke der Bereitwilligkeit Gottes zur Vergebung bekannter und bereuter Sünden war noch wenig entwickelt. Es gab zwar durchaus schon ein Bewußtsein von der Barmherzigkeit Gottes (5.8) , aber die Welt war noch nicht erlöst, der sakramentale Weg zur Sündenvergebung nicht erschlossen.
Einige Passagen des Textes haben zu der Vermutung geführt, daß der Psalm tatsächlich ganz oder teilweise ein Standardgebet wiedergibt, das Gläubige in einer entsprechenden Situation im Tempel verrichteten. Diese Ansicht stützt sich unter andrem auf die von der Weisheitslehre bestimmten Gedanken der Verse 9 – 11. Sie enthalten nicht etwa eine Verfluchung der Gegner, sondern referieren quasi „Katechismuswissen“ des frommen Juden der Zeit: Die Guten erkennt man und sie erkennen sich selbst daran, daß der Herr ihnen Gelingen schenkt, während die Pläne der Bösen zum Jubel der Gerechten mißlingen. Das ist ein reichlich diesseits-bezogenes Verständnis von Verdienst, Belohnung und Bestrafung, das aber noch in das Denken der Jünger Jesu hinüberreicht (Joh 9, 1-3). Und gerade deshalb ist es bemerkenswert, daß der folgende Vers 12 den Gedanken in einer überzeitlichen Perspektive öffnet: Der Jubel derer, die sich beim Herrn bergen, wird in Ewigkeit andauern, und der Herr wird auf immer „in ihnen wohnen“. (Hier in Vulgata eine bemerkenswerte Version des „bonae voluntatis“). Das „auf immer“ darf man für die Entstehungszeit des Psalms nicht im christlichen Sinne eines „ewigen Lebens“ verstehen; bestenfalls als dessen Vorahnung. Die frommen Juden verbanden damit vor allem die Vorstellung, daß die Gnade Gottes insofern über das Leben des Individuums hinausreicht, daß auch die Kinder und Kindeskinder in dieser Gnade gesegnet sind.
Die griechische Fassung und die Vulgata bringen diesen Gedanken weitaus stärker zum Ausdruck als die masoretische, erkennbar ist er aber auch dort. Tatsächlich gab es im jüdischen Glauben keine gefestigte Lehre von einem Weiterleben der Seele und deren Schicksal nach dem Tod. Einige Schulen, darunter nach Auskunft von Flavius Josephus zur Zeit Jesu auch die Sadduzäer, leugneten die Unsterblichkeit der Seele sogar vollständig. Der allgemeine Glaube sah die Geister der Verstorbenen als Bewohner des Schattenreiches „Schehol“, wo sie auf unbestimmte Weise dahinwesten, dem Zugang Gottes und zu Gott entzogen. Der Mensch war für viele Juden noch kein Individuum, dessen Leben mit dem Tod endet oder dessen Seele dann „für immer“ weiterlebt, sondern jeder Mensch war eingebunden in die Generationenfolge, die ihm ein überindividuelles „ewiges Leben“ versprach. Der folgende Psalm 6 enthält dazu weitere Aussagen.
An dieser und anderen Stellen wird deutlich, wie sinnvoll es für fromme Beter ist sich in ihrem Verständnis der Psalmen nicht auf eine vermeintlich allein wissenschaftlich haltbare innerjüdische Perspektive zu beschränken, sondern die Offenbarung des Neuen Testaments und deren Darlegung in der Lehre und Tradition der Kirche zum Ausgangspunkt zu nehmen. Der Gott des AT ist kein anderer als der des NT – aber sein Bild ist in der geoffenbarten Lehre der Kirche weitaus deutlicher erkennbar. In der überzeitlichen Perspektive, die bereits in der Septuaginta deutlicher sichtbar angelegt ist, kann auch der christliche Beter in diesen Psalm einstimmen, ohne Gefahr zu laufen, seine Hoffnung allzusehr auf sichtbare Genugtuung noch in dieser Welt zu setzen – und bitter enttäuscht zu werden.
Letzte Bearbeitung: 21. März 2024
*